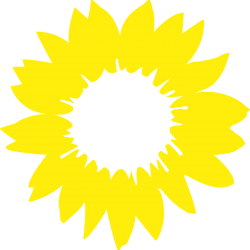Liebe Grafingerinnen, liebe Grafinger,
aus dem Feldpostbrief eines jungen Grafingers:
„Habe Euer wertes Packetchen erhalten, besten Dank. Es freut mich, da Ihr stehts an mich denkt, und mir immer etwas zukommen lasst. Hier ist man ja um jede Gabe froh. Die Zeit ist ja nun eine ernste, traurige. Die Zigarren sind wirklich fein und gut. Wir sind jetzt in der Umgebung von der Stadt Peron. Tag und Nacht in den Schützengräben. Die Franzosen sind 200 Meter vor uns eingegraben. Vorgegangen wird bei uns jetzt nicht, da im Norden zuerst vorgegangen werden muß. Wir haben es nun etwas schöner. Warm angezogen bin ich ja nun auch. Heuer werden wir uns kaum mehr sehen, noch ist keine Aussicht. Die Hauptsache ist, wenn wir wieder gesund nach Hause kommen. Mit Gruß aufs Wiedersehen Euer dankschuldiger
Paul Bartl“
Auf den Tag genau vor 102 Jahren schrieb der Grafinger Paul Bartl diesen Brief an eine befreundete Grafinger Familie.
Zwei Jahre später, am 2. September 1916, vor 100 Jahren, war er tot.
„Liebe Theres! Deine werthe Karte hab ich erhalten, besten dank dafür. Sende Dir heute eine Photographie, sie ist aber leider nicht gut ausgefallen. Bin gesund, sonst gibt’s nichts Neues. Gruß Josef Bartl“
Am 24. Mai 1916, also vor 100 und einem halben Jahr, sandte der Grafinger Josef Bartl diese Zeilen an seine Freundin Theres Zellner vom Bauern am Berg.
Zwei Jahre danach, am 9. Juni 1918, starb er im Lazarett.
Grafinger, die beiden, vermutlich verwandt.
So alt wie jetzt unserer Söhne, Brüder oder Freunde.
Wir wissen nicht, ob sie eine feindliche Granate zerrissen hat oder ob sie im Schützengraben verfault sind.
Aufgepeitscht von Politikern und Militärs, die dem Volk weiß gemacht haben, dass der „Franzos“ oder der „Russ“ Feinde waren, sind sie vielleicht sogar freudig erregt in den Krieg gezogen.
Sie waren welche von uns Grafingern und hatten wohl erst an der Front, im Schützengraben, erkannt, für welchen Unsinn sie da ihr Leben geben sollten.
Vor hundert Jahren, genau heute, jetzt, vor hundert Jahren, tobte die Schlacht von Verdun, und gleichzeitig, ein paar Kilometer weiter, die Schlacht an der Somme. Mehr gestorben wurde bis dahin nie. Hundertausende elendiglich Ermordete, keine Helden, sondern Opfer.
Der Alxing-Brucker Pfarrer Kaspar Wurfbaum hat Tagebuch geführt, während des Ersten Weltkrieges. Am 13. November 1916, also morgen vor 100 Jahren, notiert er: „Gottesdienst in Alxing; nachmittags in Grafing Konferenz. Von den Schlachtfeldern keine wesentliche Änderung.“
Bis zu diesem Zeitpunkt sind bei diesem Irrsinn schon 30 Grafinger getötet worden.
Gegen Ende des Jahres 1916 wurden erste Friedensbemühungen aufgenommen, die aber scheiterten.
Weitere 100 Grafinger sollten noch getötet werden.
Vorgestern, vor 75 Jahren, stirbt der Landarbeiter Georg Maier aus Eisendorf in einem Lazarett.
In Oberelkofen wird ihm zu Ehren eine „Heldengedenkfeier“ abgehalten.
Das politische Marketing hatte ihn zum Helden gestempelt.
Ob der sich als Held fühlte, mit seinen 20 Jahren?
Im November vor 75 Jahren ist es auch, dass die Grafingerin Martha Pilliet auf der Fahrt in den Massenmord aus Verzweiflung ihrem Leben ein Ende setzt.
Sie musste sterben, weil sie jüdischen Glaubens war, und weil diesem vermeintlichen Anders-Sein eine Gefahr angedichtet wurde.
Vor 74 Jahren, in diesen kalten Novembertagen, am 19. November, begann mit einer russischen Offensive die Einkesselung der deutschen Truppen in Stalingrad.
Bisher waren bei diesem Irrsinn schon wieder 15 Grafinger getötet worden;
weitere 145 sollten noch folgen.
Was war das doch für ein großer Irrsinn, das Ganze?
Ein großes, völlig sinnloses Töten und Sterben?
Wie war es dazu gekommen? Was führte zu diesem Schlachten?
- Großtuerei! Wichtigtuerei! Worte!
- Sprache!
- Sprache von Politikern, die auf fruchtbaren Boden fiel, aufgenommen wurde, wucherte, bedacht oder unbedacht in den Mund genommen wurde, und vom Mund in die Köpfe wanderte.
Immer, wenn es zu den großen Gräueln der deutschen Geschichte gekommen ist, waren es erst der Kaiser und dann der Führer und Mitläufer, die uns erklärt und eingeredet haben, wer nur gerade der Böse sei, wer bekämpft und vernichtet werden müsse.
Woher wusste denn der Grafinger, der da drüben beim Grandauer am Stammtisch saß, am Vorabend, bevor er in den Krieg zog, gegen wen er sein Leben aufs Spiel setzen sollte.
Und vor allem – warum?
Alles nur Gerede? Nein.
Aus Worten wurden Taten!
Vor dem Beginn einer Auseinandersetzung steht immer die Sprache, die sprachliche Vereinfachung, die sprachliche Verrohung.
- Schnell fallen Begriffe wie „Ratten“, „Gesindel“ oder „Pack“
- schnell wird betont, wie aggressiv die Anderen sind, wie gesetzlos und andersgläubig sowieso,
- schnell wird von „Flut“ gesprochen, von „Kampf“,
- … und zu spät merken wir, was wir da eigentlich nachplappern, welchen Unsinn wir da eigentlich reden.
Und nein: Es sind nicht die Anderen – die da – die Trumps, Putins, Erdogans und Orbans, die sich zunehmend dieser Sprache bedienen, es sind wir, wir alle, die diese Sprache aufnehmen, weiterverbreiten, bagatellisieren. Die Sprache des Hasses ist unter uns.
Werte, die wir für Werte gehalten haben, sind plötzlich keine Werte mehr.
Wir erleben es, auch hier, dass Rückgrat und Anstand durch Populismus ersetzt werden.
Alles nur Gerede?
- Früher gab es den Begriff „Unsagbar“ oder „Unsäglich“,
doch vieles, was vor kurzer Zeit noch „unsäglich“ war, umgibt uns heute, – ist „sagbar“ geworden. - Früher gab es die Idee von „Höflichkeit, Respekt“ auch Gegnern und Fremden gegenüber;
- Gestern noch gab es das Wort „Anstand“, in der Sprache, in unseren Äußerungen, in unserem Umgang miteinander, in unserem Umgang auch mit dem Unbekannten.
Heute hört viel zu oft man „Das wird man doch wohl noch sagen dürfen!“
Ja, man darf, man soll sagen dürfen, dass es Probleme gibt – aber bitte sachlich, höflich, mit Respekt, mit Anstand. - Und manchmal muss man eben auch seinen Freunden sagen dürfen, Freunden, die unsägliches daherreden: „Okay, aber jetzt reicht’s“
Wir wissen nicht, wohin uns diese Verrohung der Sprache führt, aber wir wissen, wohin sie immer wieder schon geführt hat, wohin sie führen kann.
Passen wir auf – auf unsere Sprache!
Wieder wird uns Angst gemacht, Angst vor der Zukunft, Angst vor Veränderung, Angst vor Anderen, vor Mitmenschen;
Angst davor, dass nichts mehr so bleibt, wie es ist.
Die Schuldigen werden auch gleich mit benannt – und die Retter auch.
Hatten wir das nicht schon mal?
Aber: Müssen wir wirklich Angst haben?
Sind wir, unser Rechtsstaat, unsere Kultur nicht stark genug, mit der Zukunft zurecht zu kommen? Wir sind stark!
Ich rufe Sie auf: Der Widerstand gegen die Brutalisierung des Alltags fängt beim Widerstand gegen die Brutalisierung der Sprache an.
Passen wir auf! Verwenden wir nicht die Sprache des Bösen, die Sprache der Ausgrenzung, die Sprache der Verrohung.
Bleiben wir bei der Sprache der Mitmenschlichkeit!